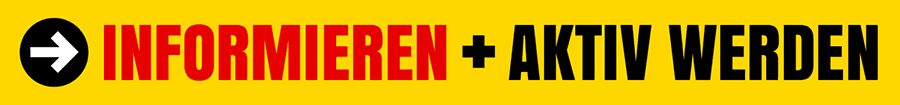Manche Menschen finden ja, früher war alles besser. Mit früher sind vermutlich die 1950er und 1960er Jahre gemeint – Wirtschaftswunder, Vollbeschäftigung, Frauen am Herd, Migrant*innen unsichtbar. Es war aber auch die Zeit, als Frauen per Gesetz für den Haushalt zuständig waren und als „Gastarbeiter“ die Drecksarbeit machten und wenig Ansprüche stellten. Schlichtweg, weil sie die Sprache nicht beherrschten. Früher war alles besser? Das gilt höchstens für weiße Männer.
Ich finde, heute ist vieles besser: Vergewaltigung in der Ehe ist strafbar, Frauen mischen überall mit und auch bei Migrant*innen und ihren Nachkommen hat sich viel getan. Immer mehr machen Abschlüsse, Ausbildungen, studieren oder besetzen politische Ämter. Und sie sind keine kleine Minderheit mehr, die man vernachlässigen kann: Bundesweit haben 26 Prozent der Menschen in Deutschland einen sogenannten Migrationshintergrund. Doch das ist nur der Durchschnitt. Die meisten von ihnen leben in westdeutschen Städten und hier ist ihr Anteil deutlich höher: in Stuttgart 46 Prozent, in Nürnberg 47 Prozent, in Frankfurt schon 54 Prozent. In der Hauptstadt Berlin, die als besonders international wahrgenommen wird, liegt er bei gerade einmal 35 Prozent.
Bei den Unter-18-Jährigen liegt der Anteil noch höher, hier sind Menschen aus Einwandererfamilien keine Minderheit mehr. In Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Nürnberg, Hannover, Bremen, Wiesbaden sind es schon 50 bis 60 Prozent. In Frankfurt am Main sogar über 70 Prozent. Man kann das nun so sehen, dass sich die deutsche Gesellschaft – mal wieder – verändert. Oder man sorgt sich darum, dass sich das deutsche Volk abschafft. So oder so müssen die Vergangenheitsromantiker der Realität ins Auge blicken: Die goldene Zeit des weißen Mannes ist vorbei.
People of Color und Schwarze Menschen werden in der Gesellschaft sichtbarer und stellen Ansprüche, zum Beispiel auf gleichberechtigte Teilhabe und eine Debatte über strukturellen Rassismus. Nicht alle, die sonst laut „integriert euch“ rufen, finden das gut. Man könnte den Rechtsruck der letzten Jahre also auch als Reaktion auf gelungene Integration interpretieren. Sozialwissenschaftler*innen wie Naika Foroutan und Aladin El-Mafaalani erklären, dass fortschreitende Diversität in allen Bereichen einer Gesellschaft Rassismus befördert. Dass Menschen aus Einwandererfamilien sich emanzipieren, führt bei manchen Ureinheimischen zu Abwehr. Laut El-Mafaalani ein normaler Vorgang, auf dem „Weg zu einer offenen Gesellschaft“. Trotzdem baut sich der Rassismus nicht einfach von selbst ab. Und gleichberechtigte Teilhabe ist kein Selbstläufer. Was also muss passieren?
Es ist überfällig, gegen strukturellen Rassismus vorzugehen. Woran man ihn erkennt? Deutschland ist superdivers, seine Institutionen sind es nicht. Damit man mangelnde Repräsentation aber als Indiz für Rassismus erkennt, brauchen wir eine rechtliche Definition von Rassismus, die strukturellen Rassismus durch diskriminierende Ausschlüsse beinhaltet. Und dann brauchen wir einen großen Kulturwandel. Behörden, Parteien, Medien, Wohlfahrtsverbände, aber auch Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräte, Berufsverbände und andere müssen sich öffnen. Wie?
- Durch eine ehrliche Bestandsaufnahme, wie es um Vielfalt und Diskriminierung in der eigenen Institution oder Organisation steht.
- Durch eine Führungsebene, die Diversität zur Chef*innensache erklärt und proaktiv fördert.
- Durch verbindliche Einstellungs-Quoten für Menschen aus diskriminierten Gruppen. Nette Worte und ein paar mehr Migrant*innen, Schwarze und People of Color mehr unter den Azubis reichen nicht. Es braucht eine kritische Masse.
- Durch eine Organisationskultur, die vielfältige Identitäten und Erfahrungen wertschätzt.
- Durch ein positives Klima mit konsequentem Diskriminierungsschutz, auch in der eigenen Institution.
Und last but not least: Rassismus fängt da an, wo Menschen unterschiedlich behandelt werden – wegen ihres Namens, Aussehens, ihrer Herkunft oder Religion. Und wenn wir ehrlich sind, ist niemand frei davon. Das zu verstehen und Gruppen zu unterstützen, die sich gegen Rassismus engagieren – das kann jede*r von uns tun.
Zur Person:
Ferda Ataman ist Journalistin und hat 2019 die Streitschrift „Hört auf zu fragen. Ich bin von hier“ veröffentlicht. Sie ist außerdem Vorsitzende im Verein „Neue deutsche Medienmacher*innen“, der größten bundesweiten Initiative von Journalist*innen, die sich für Vielfalt in den Medien einsetzen.