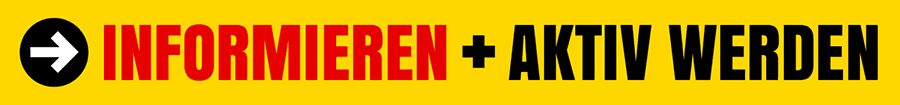Er ist momentan einer der gefragtesten Antirassismus-Aktivisten Deutschlands: Ali Can. Bekannt wurde der 26-Jährige durch Initiativen wie die „Hotline für besorgte Bürger“, bei der er am Telefon über Themen der Migration sprach, aufklärte und Ängste nahm. Seiner darauffolgenden Kampagne #metwo folgten zehntausende Menschen, die ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus in den Sozialen Medien erzählten, darüber diskutierten und so Rassismus sichtbar machten. Kürzlich erschien sein neues Buch „Mehr als eine Heimat. Wie ich Deutschsein neu definiere“. Wir haben Ali Can getroffen und mit ihm über Vielfalt, „Deutsch-Sein“, das Engagement gegen Rassismus und die Rolle der Gewerkschaften gesprochen.
Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du willst dich engagieren und auf welche Weise hast du das getan?
In den Jahren 2014 und 2015 hat sich mit der zunehmenden Einwanderung von Geflüchteten im Land etwas verändert. Rechtspopulisten wurden stärker, Bewegungen wie Pegida größer. Selbst Menschen aus meinem Umfeld haben den ein oder anderen diskriminierenden Spruch `rausgelassen. Auch in der Familie meiner damaligen deutschen Freunde kamen solche Aussagen. Das hat mich getroffen, denn ich war mal selbst einst ein Asylsuchender, meine Familie war bis 2007 geduldet und sollte abgeschoben werden. Irgendwann habe ich das Video gesehen von einem wütenden Mob in Clausnitz, der einen ankommenden Bus mit Geflüchteten blockierte. Darin sieht man einen weinenden Jungen, der sich an die Mutter klammert. Da war mein persönliches Fass übergelaufen. Ich wollte aber nicht den gleichen Fehler machen wie Rechtspopulisten und pauschal über den Ort urteilen. Also musste ich die Menschen kennenlernen. Ich habe eine Reise in den Osten gemacht, habe Erfahrungen aus erster Hand gesammelt, Gespräche geführt, die mich geprägt haben. Ich bin in Kneipen gegangen, in Orte, die ich aus den Medien kannte. Und ich bin auch zu Pegida. Das war die erkenntnisreichste Station. Das war 2016 kurz vor Ostern. Zunächst stieß ich auf Ablehnung. Als ich dann mit einem Schoko-Osterhasen demonstrativ durch die Menge lief, kam ich plötzlich mit den Leuten ins Gespräch. Was ich gelernt habe: Aus ihrer Perspektive hatten wir jetzt einen gemeinsamen Nenner. Jetzt kamen die Leute zu mir, sie waren aus eigenem Antrieb motiviert. So banal diese Geschichte klingt, in ihr steckt so viel Tiefe. All mein Engagement, was danach kam, kommt aus dieser Situation. Und ich habe meine Schubladen über “Ostdeutsche” neu sortiert.
War das dann die Initialzündung für die „Hotline für besorgte Bürger“?
Ja genau. Diese Erfahrungen waren die Basis, die Erkenntnis über den gemeinsamen Nenner. Ich war Ansprechpartner am Telefon für „besorgte Bürger“, ich wollte das Feld der Menschen, die Ängste haben, nicht den Radikalen und Demagogen überlassen. Ich habe Aufklärungs- und Bildungsarbeit für Leute gemacht, die wie in einer Drehtür sind – sie können nach rechts gehen, aber sie können auch umdrehen. Damit wollte ich, dass nicht die Demagogen die Stimme dieser Leute werden. Das war der große Beginn meines politischen Sozialaktivismus.
Noch größere Öffentlichkeit erlangte später dein Hashtag #metwo, der angelehnt war an die amerikanische metoo-Kampagne gegen Sexismus. Dein „me two“ bedeutet „Ich zwei“. Was waren das Ziel und die Wirkung?
Marginalisierte Gruppen müssen sich in den öffentlichen Raum trauen, sie müssen sich ihn ja leider erstreiten. Für eine große Veränderung sind persönliche Geschichten die besten. Wir müssen dieser großen, anonymen Masse von Flüchtlingen und Migranten Gesichter geben. Ich habe #metwo ins Leben gerufen, um sichtbar zu sein, um mitreden zu können. Gleichzeitig war es ein Paradigmenwechsel: Davor habe ich geredet, um die aufnehmende Gesellschaft offener zu machen. Jetzt ging es um Empowerment, um Betroffene, die wir zu selten im Blick haben. Das war also ergänzend, komplementär. Diese Seite ist wichtig. Ich versuche beide Seiten mitzudenken und das ist keine Frage der Abwägung. Es geht um eine Vision, plurale Identitäten zu akzeptieren. Deswegen der Hashtag „Ich zwei“. Diese Menschen sind deutsch und noch etwas anderes – nicht oder. Wir versuchen heutzutage immer noch ein Oder daraus zu machen: Bist du deutsch oder türkisch? Die gesammelten Alltagsgeschichten sollten die Vielfalt der Identitäten verdeutlichen und Vielfalt fördern.
Du hast diesem Thema ein ganzes Buch gewidmet und über das „Deutsch-Sein“ geschrieben. Über 20 Mio. Menschen in Deutschland haben diese pluralen Identitäten, haben Migrationsbiografien. Warum ist Vielfalt auch heute noch keine Selbstverständlichkeit?
Zum einen hat das historische Gründe. Wir deklarierten die Menschen als „Gastarbeiter“. Bis in die 80er Jahre gab es Prämien des deutschen Staates, wenn Menschen z.B. in die Türkei zurückgingen. 10 000 D-Mark. Zum anderen ist Vielfalt für viele deshalb schwer zu akzeptieren, weil sie durch die deutsche Geschichte sinnbildlich nicht den Boden unter den Füßen haben. Es brauchte erst Zeit und eine Akzeptanz. Ich glaube, dass einiges aus dieser Denke noch nicht richtig abgeschlossen ist. Was sind wir jetzt wirklich? Vor ein, zwei Generationen hat man sich noch geschämt zu sagen: Ich bin Deutscher. Wie wollen Menschen, wenn sie über Identität reden, das positiv und plural besetzen, wenn sie schon mit einer Identität in einem sehr komplexen Verhältnis zu deutschen Geschichte stehen? Es ist bislang nicht gelungen, diese starke Verantwortung der Geschichte zu übernehmen und diese Erinnerungskultur nachhaltig und zukunftsorientiert zu pflegen und daneben gleichzeitig eine neuzeitliche Auslegung von Identität zu akzeptieren. Identität wurde davor immer nur als Einbahnstraße gesehen, als etwas Monotones und Homogenes. Und daher schwingt immer noch etwas Schweres mit, wenn man über Deutsch-Sein redet. Das ändere ich mit meinem neuen Buch.
Es gibt jedoch politische Kräfte, die diesen Weg eines Deutschlands in Vielfalt nicht mitgehen wollen. Teile der AfD, Pegida oder die Identitäre Bewegung haben ein völkisches Verständnis von Identität. Diese Ideen erstarken wieder. Was können wir dem entgegensetzen?
Der große Unterschied zwischen Engagement früher und heute, ist, dass das früher aus einer „Underdog“-Rolle geschah. Meine Eltern hatten keine Bildung, aber ich kann mitreden und eine Öffentlichkeit haben. Solche Leute wie ich können Brückenbauer sein, sie können ihre Perspektive in das kulturelle Gedächtnis miteinfließen lassen. Erst jetzt wird diese Geschichte der Vielfalt in Museen und Lehrbüchern erzählt. Jetzt erst wird die Sprache hinterfragt. Jetzt kommen wir dazu, eigentlich das umzusetzen, was im Grundgesetz steht: Artikel 3, die Gleichheit der Menschen. Durch die Reflexion kommt es jetzt zu Umsetzung. Leider fehlt es aber oft an Kreativität. Wir brauchen Erfindergeist nicht nur für Technologien „Made in Germany“, sondern für das Miteinander in Deutschland.
Es gibt jedoch starke rassistische Abwehrreflexe in Teilen der Bevölkerung. Wo ziehen wir die Grenze?
Es gibt einen Unterschied zwischen dem Umgang mit Parteifunkionären und mit Bürgern einer Gemeinde, die gerade noch eine freiwillige Feuerwehr im Dorf haben. Diese Leute haben das Gefühl, dass ihnen etwas weggenommen wird und Demagogen können das für sich nutzen. Der zweite Punkt ist eng damit verknüpft: Was ist justiziabel und was hat unser Rechtsstaat für Mittel? Und nutzen wir die richtig? Denn von Rassismus Betroffene haben das Problem, dass sie oft nicht in die Institutionen wie Polizei oder Verfassungsschutz vertrauen. Um eine rote Linie zu ziehen, müssen wir die Zivilgesellschaft sensibilisieren, empowern, Verbündete finden, in der Hoffnung, dass diese Partei weniger gewählt wird. Da bin ich wieder bei meinem Dialogangebot, bei der Offenheit. Räume, wie hier im VielRespekt-Zentrum, schaffen Begegnung. Aber da, wo Leute aus Kalkül Dinge sagen, um Stimmung zu machen, da brauchen wir entschiedenes Handeln mit allen rechtlichen Mitteln.
Wir haben viel über Identitätsfragen gesprochen, es spielen aber auch soziale Aspekte eine Rolle. Es gibt Unsicherheiten im Arbeitsleben, Abstiegsängste im Zuge von Standortkonkurrenz und Globalisierung. Das spielt Rechtspopulisten in die Karten. Was können in der Arbeitswelt Gewerkschaften leisten?
Gewerkschaften werden nicht darum herumkommen, die Firmenkultur ändern zu müssen. Früher hat man vielleicht stärker Arbeit und Gesellschaftsleben getrennt. Das geht nicht mehr. Wir erleben gerade, in Schulen und anderen Bereichen, dass Dinge hinterfragt werden, dass sensibilisiert wird. Auch bei der Arbeit müssen die Leute merken, wie viel gesellschaftliche Verantwortung sie haben. Und im Lichte dieser Verantwortung für die Mitmenschen und die Gesellschaft müssen sie dafür einstehen, dass man auch auf der Arbeit nicht alles sagen darf, dass niemand rassistisch beleidigt werden darf. Es geht um die Würde. Es braucht Augenhöhe und Wertschätzung. Um rassistische Vorfälle im Vorfeld zu vermeiden, bräuchte es aber einen langen Prozess der Sensibilisierung. Da gibt es meines Wissens wenig Kreativität. Ich kenne wenige Vereine wie die Gelbe Hand, die im Vorfeld ein Programm auffahren zur Schlichtung und Konfliktbewältigung. Davon bräuchte es mehr.
In der Tat ist das unsere Hauptaufgabe. In unserem Projekt „Aktiv im Betrieb“ haben wir z.B. gemeinsam mit Partnerbetrieben Module entwickelt, um Themen wie Konfliktlösung, Demokratie und Antirassismus nachhaltig in Ausbildungsgänge zu implementieren. Die Arbeitswelt ist als Handlungsfeld erkannt, aber ja, es bräuchte flächendeckend Präventionsarbeit und Sensibilisierung.
Daher braucht es starke Gewerkschaften. Ja, das stimmt. Gewerkschaften sind für mich die handelnden Parlamente, die Stimme der arbeitenden Menschen. Nicht alle haben immer die Zeit, sich außerhalb des harten Arbeitslebens in der Freizeit auch politisch dafür aufzuopfern. Daher sind die Gewerkschaften wichtige, starke Partner, die den Menschen eine Stimme geben und sozusagen „an der Front“ sind mit den Konzernchefs, mit der Politik. Die Gewerkschaften sind der einzige „safe space“ (geschützter Raum, Anm. d. Red.) für die Arbeitnehmer*innen, um diese sozialen Themen voranzutreiben. Deswegen bin ich oft bei den Gewerkschaften. Wenn es sie nicht gäbe, wäre es nicht nur ein rein wirtschaftlich kapitalistisches Land, sondern es wäre auch eine zwischenmenschlich kalte Gesellschaft.